Rechtssache Katzenbach gegen Morgan, Argumente, Auswirkungen
 Share
Share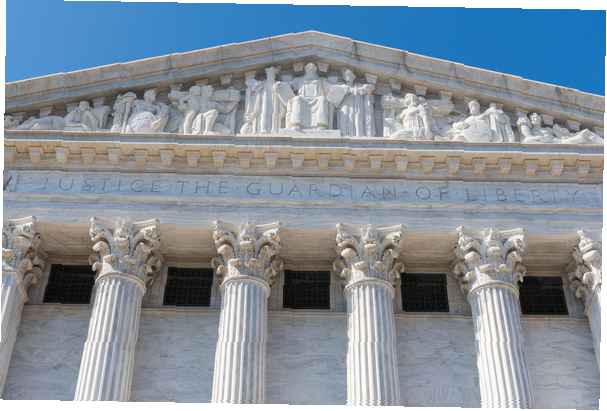
In der Rechtssache Katzenbach gegen Morgan (1966) entschied der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten, dass der Kongress seine Befugnisse bei der Ausarbeitung von Abschnitt 4 (e) des Stimmrechtsgesetzes von 1965, in dem das Stimmrecht auf eine Gruppe von Wählern ausgedehnt wurde, nicht überschritten hatte weg bei den Wahlen, weil sie Alphabetisierungstests nicht bestehen konnten. Der Fall hing von der Auslegung der Durchsetzungsklausel der vierzehnten Änderung durch den Obersten Gerichtshof ab.
Fast Facts: Katzenbach gegen Morgan
- Argumentierter Fall: 18. April 1966
- Entscheidung erlassen: 13. Juni 1966
- Antragsteller: US-Generalstaatsanwalt Nicholas Katzenbach, New Yorker Wahlbehörde, et al
- Befragter: John P. Morgan und Christine Morgan, Vertreter einer Gruppe von New Yorker Wählern, die an der Aufrechterhaltung von Alphabetisierungstests interessiert sind
- Schlüsselfrage: Hat der Kongress die ihm gemäß der Durchsetzungsklausel der vierzehnten Änderung erteilte Befugnis überschritten, als er Abschnitt 4 (e) in das Stimmrechtsgesetz von 1965 aufgenommen hat? Verstieß dieser Gesetzgebungsakt gegen den zehnten Änderungsantrag??
- Mehrheit: Richter Warren, Black, Douglas, Clark, Brennan, White und Fortas
- Abweichend: Richter Harland und Stewart
- Entscheidung: Der Kongress übte seine Befugnisse ordnungsgemäß aus, als der Gesetzgeber Abschnitt 4 (e) des Stimmrechtsgesetzes von 1965 anordnete, der darauf abzielte, den Gleichbehandlungsschutz auf eine entrechtete Gruppe von Wählern auszudehnen.
Fakten des Falls
In den 1960er Jahren hatte New York, wie in vielen anderen Bundesstaaten, damit begonnen, vor der Erlaubnis zu wählen, dass Einwohner Lese- und Schreibtests bestehen müssen. New York hatte eine beträchtliche Bevölkerung von puertoricanischen Einwohnern, und diese Lese- und Schreibtests hinderten einen großen Teil von ihnen daran, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. 1965 verabschiedete der Kongress der Vereinigten Staaten das Voting Rights Act, um diskriminierende Praktiken zu beenden, die Minderheiten von der Stimmabgabe ausschließen. Abschnitt 4 (e) des Stimmrechtsgesetzes von 1965 bezog sich auf die Entrechtung in New York. Es las:
„Niemandem, der die sechste Grundschulklasse an einer öffentlichen Schule oder einer von der Commonwealth of Puerto Rico akkreditierten Privatschule mit einer anderen Unterrichtssprache als Englisch erfolgreich abgeschlossen hat, wird das Wahlrecht verweigert, weil seiner Unfähigkeit, Englisch zu lesen oder zu schreiben. “
Eine Gruppe von New Yorker Wählern, die New Yorks Alphabetisierungstestanforderungen durchsetzen wollten, verklagte den US-Generalstaatsanwalt Nicholas Katzenbach, dessen Aufgabe es war, das Stimmrechtsgesetz von 1965 durchzusetzen. Ein aus drei Richtern bestehendes Bezirksgericht verhandelte den Fall. Das Gericht entschied, dass der Kongress mit der Verabschiedung von Abschnitt 4 (e) des Stimmrechtsgesetzes die Grenzen überschritten hatte. Das Amtsgericht hat eine Feststellung und einstweilige Verfügung erlassen. Der US-Generalstaatsanwalt Katzenbach legte gegen die Feststellung direkt Berufung beim Obersten Gerichtshof der USA ein.
Verfassungsfragen
Die zehnte Änderung räumt den Staaten ein, "Befugnisse, die von der Verfassung nicht an die Vereinigten Staaten delegiert oder von ihr an die Staaten verboten wurden". Zu diesen Befugnissen gehörte traditionell die Durchführung von Kommunalwahlen. In diesem Fall musste der Gerichtshof feststellen, ob die Entscheidung des Kongresses, § 4 (e) des Stimmrechtsgesetzes von 1965 zu erlassen, gegen die zehnte Änderung verstieß. Hat der Kongress die den Staaten übertragenen Befugnisse verletzt??
Argumente
Anwälte, die New Yorker Wähler vertraten, argumentierten, dass einzelne Staaten die Möglichkeit hätten, ihre eigenen Wahlbestimmungen zu schaffen und durchzusetzen, solange diese Bestimmungen nicht die Grundrechte verletzen. Alphabetisierungstests sollten Wähler, deren Muttersprache nicht Englisch war, nicht entrechtet werden. Stattdessen beabsichtigten Staatsbeamte, die Tests zu nutzen, um die Englischkenntnisse bei allen Wählern zu fördern. Der Kongress konnte seine Gesetzgebungsbefugnisse nicht nutzen, um die Politik des Staates New York außer Kraft zu setzen.
Anwälte, die die Interessen des Stimmrechtsgesetzes von 1965 vertraten, argumentierten, dass der Kongress Abschnitt 4 (e) als Mittel zur Beseitigung eines Hindernisses für die Wahl einer Minderheitsgruppe verwendet habe. Gemäß dem vierzehnten Zusatz hat der Kongress die Befugnis, Gesetze zu erlassen, die auf den Schutz von Grundrechten wie das Wählen abzielen. Der Kongress hatte innerhalb seiner Befugnisse gehandelt, als er die betreffende Sektion der VRA gestaltete.
Mehrheitsmeinung
Richter William J. Brennan gab die 7: 2-Entscheidung ab, die Abschnitt 4 (e) des VRA bestätigte. Der Kongress handelte im Rahmen seiner Befugnisse gemäß Abschnitt 5 der 14. Änderung, auch als Durchsetzungsklausel bekannt. Abschnitt 5 verleiht dem Kongress die "Befugnis, den Rest des vierzehnten Verfassungszusatzes durch geeignete Gesetze durchzusetzen". Richter Brennan stellte fest, dass Abschnitt 5 eine "positive Gewährung" der Gesetzgebungsbefugnis darstellt. Es ermöglichte dem Kongress, nach eigenem Ermessen zu bestimmen, welche Art von Rechtsvorschriften sind erforderlich, um den Schutz der vierzehnten Änderung zu erreichen.
Um festzustellen, ob der Kongress im Rahmen der Durchsetzungsklausel handelte, stützte sich Richter Brennan auf den "Angemessenheitsstandard", einen Test, den der Oberste Gerichtshof in McCulloch gegen Maryland entwickelt hatte. Nach dem "Angemessenheitsstandard" konnte der Kongress Gesetze in dieser Reihenfolge erlassen die Gleichbehandlungsklausel durchzusetzen, wenn die Gesetzgebung:
- Im Streben nach einem legitimen Mittel zur Gewährleistung des gleichen Schutzes
- Einfach angepasst
- Verstößt nicht gegen den Geist der US-Verfassung
Richter Brennan stellte fest, dass Abschnitt 4 (e) angenommen wurde, um ein Ende der diskriminierenden Behandlung einer Reihe von Einwohnern Puertoricas zu gewährleisten. Der Kongress verfügte nach dem vierzehnten Verfassungszusatz über eine angemessene Grundlage für die Verabschiedung der Rechtsvorschriften, und die Rechtsvorschriften standen in keinem Widerspruch zu anderen verfassungsmäßigen Freiheiten.
Abschnitt 4 (e) stellte nur das Stimmrecht für Puertoricaner sicher, die eine akkreditierte öffentliche oder private Schule bis zur sechsten Klasse besuchten. Richter Brennan merkte an, dass der Kongress nicht als Verstoß gegen die dritte Säule der Angemessenheitsprüfung angesehen werden könne, nur weil die von ihm gewählte Gesetzgebung nicht alle Puertoricaner entlastet habe, die die Prüfung der Englischkenntnisse nicht bestehen könnten.
Richter Brennan schrieb:
"Eine Reformmaßnahme wie § 4 (e) ist nicht ungültig, weil der Kongress möglicherweise weiter gegangen ist als er und nicht das ganze Übel gleichzeitig beseitigt hat."
