Kurt Gerstein Ein deutscher Spion in der SS
 Share
Share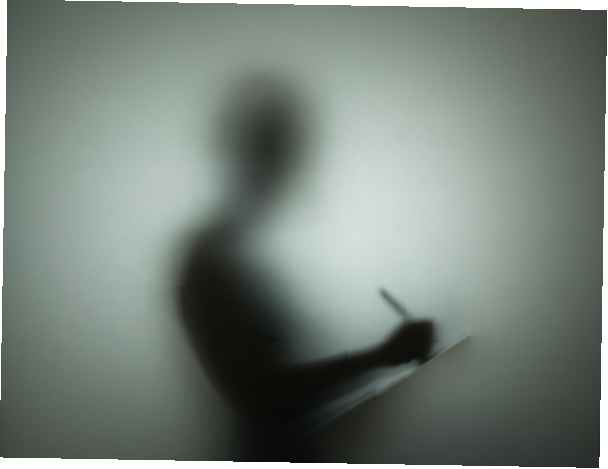
Anti-Nazi Kurt Gerstein (1905-1945) wollte nie Zeuge des nationalsozialistischen Mordes an den Juden sein. Er schloss sich der SS an, um herauszufinden, was mit seiner Schwägerin geschah, die auf mysteriöse Weise in einer Nervenheilanstalt gestorben war. Gerstein war bei der Infiltration der SS so erfolgreich, dass er Zeuge von Vergasungen in Belzec werden konnte. Gerstein sagte dann allen, er könne über das, was er sah, nachdenken, und doch wurde nichts unternommen. Manche fragen sich, ob Gerstein genug getan hat.
Kurt Gerstein
Kurt Gerstein wurde am 11. August 1905 in Münster geboren. Gerstein wuchs als kleiner Junge während des Ersten Weltkriegs und der folgenden turbulenten Jahre in Deutschland auf und konnte sich dem Druck seiner Zeit nicht entziehen.
Er wurde von seinem Vater gelehrt, Befehle ohne Frage zu befolgen; Er stimmte der wachsenden patriotischen Leidenschaft zu, die den deutschen Nationalismus vertrat, und er war nicht immun gegen die zunehmenden antisemitischen Gefühle der Zwischenkriegszeit. So trat er am 2. Mai 1933 der NSDAP bei.
Gerstein stellte jedoch fest, dass ein Großteil des nationalsozialistischen Dogmas gegen seinen starken christlichen Glauben verstieß.
Wende dich gegen die Nazis
Während des Studiums engagierte sich Gerstein sehr für christliche Jugendgruppen. Auch nach seinem Abschluss als Bergbauingenieur im Jahr 1931 blieb Gerstein in den Jugendgruppen, insbesondere im Bund Deutscher Bibelkreise (bis zur Auflösung im Jahr 1934), sehr aktiv..
Am 30. Januar 1935 besuchte Gerstein das antichristliche Stück "Wittekind" am Stadttheater in Hagen. Obwohl er unter zahlreichen Nazi-Mitgliedern saß, stand er an einem Punkt des Stücks auf und rief: "Das ist unerhört! Wir werden nicht zulassen, dass unser Glaube ohne Protest öffentlich verspottet wird!"1 Für diese Aussage bekam er ein blaues Auge und mehrere Zähne wurden ausgeschlagen.2
Am 26. September 1936 wurde Gerstein wegen antinazistischer Aktivitäten verhaftet und inhaftiert. Er war verhaftet worden, weil er Einladungen an Eingeladene des Deutschen Bergarbeiterverbandes mit NS-Briefen versehen hatte.3 Bei der Durchsuchung von Gersteins Haus wurden weitere von der Konfessionskirche herausgegebene Anti-Nazi-Briefe zusammen mit 7.000 adressierten Umschlägen als versandbereit befunden.4
Nach der Verhaftung wurde Gerstein offiziell aus der NSDAP ausgeschlossen. Nach sechs Wochen Haft wurde er freigelassen und musste feststellen, dass er seinen Job in den Minen verloren hatte.
Wieder verhaftet
Gerstein konnte keine Arbeit finden und ging wieder zur Schule. Er begann ein Theologiestudium in Tübingen, wechselte aber bald zum Evangelischen Missionsinstitut, um Medizin zu studieren.
Nach zweijähriger Verlobung heiratete Gerstein am 31. August 1937 die Pastorentochter Elfriede Bensch.
Obwohl Gerstein bereits als Warnung vor seinen Anti-Nazi-Aktivitäten den Ausschluss aus der NSDAP erlitten hatte, nahm er seine Verbreitung solcher Dokumente bald wieder auf. Am 14. Juli 1938 wurde Gerstein erneut festgenommen.
Diesmal wurde er in das KZ Welzheim verlegt, wo er sehr depressiv wurde. Er schrieb: "Mehrmals war ich in der Lage, mich zu erhängen und mein Leben auf andere Weise zu beenden, weil ich nicht die geringste Ahnung hatte, ob oder wann ich jemals aus diesem Konzentrationslager entlassen werden sollte."5
Am 22. Juni 1939, nachdem Gerstein aus dem Lager entlassen worden war, ging die NSDAP in Bezug auf seinen Parteistand noch drastischer gegen ihn vor - sie entließ ihn offiziell.
Gerstein tritt der SS bei
Anfang 1941 starb Gersteins Schwägerin Bertha Ebeling auf mysteriöse Weise in der Hadamar-Anstalt. Gerstein war schockiert über ihren Tod und war entschlossen, in das Dritte Reich einzudringen, um die Wahrheit über die zahlreichen Todesfälle in Hadamar und ähnlichen Einrichtungen herauszufinden.
Am 10. März 1941, eineinhalb Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, trat Gerstein der Waffen-SS bei. Bald wurde er in die Sanitätsabteilung des Sanitätsdienstes versetzt, wo es ihm gelang, Wasserfilter für deutsche Truppen zu erfinden - zur Freude seiner Vorgesetzten.
Gerstein war aus der NSDAP entlassen worden, hätte also keine Parteiposition innehaben dürfen, insbesondere nicht Teil der NSDAP-Elite. Anderthalb Jahre lang blieb der Beitritt des Anti-Nazi-Gersteins zur Waffen-SS für diejenigen, die ihn entlassen hatten, unbemerkt.
Im November 1941 sah ihn ein Mitglied des nationalsozialistischen Gerichts, das Gerstein entlassen hatte, bei einer Beerdigung von Gersteins Bruder in Uniform. Obwohl die Informationen über seine Vergangenheit an die Vorgesetzten von Gerstein weitergegeben wurden, war er aufgrund seiner technischen und medizinischen Fähigkeiten - nachgewiesen durch den funktionierenden Wasserfilter - zu wertvoll, um entlassen zu werden. Gerstein durfte daher auf seinem Posten bleiben.
Zyklon B
Drei Monate später, im Januar 1942, wurde Gerstein zum Leiter der Abteilung für technische Desinfektion der Waffen-SS ernannt, wo er mit verschiedenen giftigen Gasen arbeitete, darunter auch mit Zyklon B..
Am 8. Juni 1942 wurde Gerstein als Leiter der Abteilung Technische Desinfektion von SS-Sturmbannführer Rolf Günther vom Reichssicherheitshauptamt besucht. Günther befahl Gerstein, 220 Pfund Zyklon B an einen Ort zu liefern, der nur dem Fahrer des Lastwagens bekannt ist.
Die Hauptaufgabe von Gerstein bestand darin, die Durchführbarkeit einer Umstellung der Aktion Reinhard-Gaskammern von Kohlenmonoxid auf Zyklon B zu prüfen.
Im August 1942 wurde Gerstein nach der Abholung des Zyklon B aus einer Fabrik in Kolin (nahe Prag, Tschechische Republik) nach Majdanek, Belzec und Treblinka gebracht.
Belzec
Gerstein kam am 19. August 1942 in Belzec an, wo er den gesamten Prozess der Vergasung einer Zugladung Juden miterlebte. Nach dem Entladen von 45 mit 6.700 Menschen gefüllten Waggons wurden die noch lebenden marschiert, völlig nackt und sagten, dass ihnen kein Schaden zugefügt würde. Nachdem die Gaskammern gefüllt waren:
Unterscharführer Hackenholt unternahm große Anstrengungen, um den Motor zum Laufen zu bringen. Aber es geht nicht. Kapitän Wirth kommt hoch. Ich kann sehen, dass er Angst hat, weil ich bei einer Katastrophe anwesend bin. Ja, ich sehe alles und warte. Meine Stoppuhr zeigte alles, 50 Minuten, 70 Minuten, und der Diesel sprang nicht an. Die Leute warten in den Gaskammern. Vergeblich. Man hört sie weinen, "wie in der Synagoge", sagt Professor Pfannenstiel, die Augen an ein Fenster in der Holztür geklebt. Wütend schlägt Kapitän Wirth den Ukrainer, der Hackenholt zwölf, dreizehn Mal assistiert, ins Gesicht. Nach 2 Stunden und 49 Minuten - die Stoppuhr zeichnete alles auf - startete der Diesel. Bis zu diesem Moment lebten die Menschen, die in diesen vier überfüllten Kammern eingesperrt waren, noch, viermal 750 Personen auf viermal 45 Kubikmetern. Weitere 25 Minuten sind vergangen. Viele waren bereits tot, das konnte man durch das kleine Fenster sehen, weil eine elektrische Lampe im Inneren die Kammer für einige Momente beleuchtete. Nach 28 Minuten waren nur noch wenige am Leben. Nach 32 Minuten waren schließlich alle tot. 6
Gerstein wurde dann die Verarbeitung der Toten gezeigt:
Zahnärzte hämmerten goldene Zähne, Brücken und Kronen aus. In ihrer Mitte stand Kapitän Wirth. Er war in seinem Element und zeigte mir eine große Dose voller Zähne. Er sagte: "Überzeugen Sie sich vom Gewicht dieses Goldes! Es ist erst von gestern und vom Vortag. Sie können sich nicht vorstellen, was wir jeden Tag finden - Dollars , Diamanten, Gold. Sie werden es selbst sehen! " 7
Der Welt sagen
Gerstein war schockiert von dem, was er gesehen hatte. Er erkannte jedoch, dass seine Position als Zeuge einzigartig war.
Ich war einer der wenigen Menschen, die jede Ecke des Establishments gesehen hatten, und mit Sicherheit der einzige, der es als Feind dieser Mörderbande besucht hatte. 8
Er begrub die Zyklon B-Kanister, die er in die Vernichtungslager bringen sollte. Er war erschüttert von dem, was er gesehen hatte. Er wollte der Welt zeigen, was er wusste, damit sie es aufhalten konnten.
Auf dem Rückweg nach Berlin traf Gerstein den schwedischen Diplomaten Baron Göran von Otter. Gerstein erzählte von Otter alles, was er gesehen hatte. Wie von Otter das Gespräch erzählt:
Es war schwer, Gerstein dazu zu bringen, seine Stimme leise zu halten. Wir standen die ganze Nacht zusammen da, ungefähr sechs Stunden oder vielleicht acht. Und immer wieder erinnerte sich Gerstein daran, was er gesehen hatte. Er schluchzte und verbarg sein Gesicht in seinen Händen. 9
Von Otter berichtete ausführlich über sein Gespräch mit Gerstein und sandte es an seine Vorgesetzten. Nichts ist passiert. Gerstein erzählte weiter, was er gesehen hatte. Er versuchte, Kontakt mit der Gesandtschaft des Heiligen Stuhls aufzunehmen, erhielt jedoch keinen Zugang, weil er Soldat war.10
Ich nahm mein Leben jeden Moment in die Hand und informierte weiterhin Hunderte von Menschen über diese schrecklichen Massaker. Darunter die Familie Niemöller; Dr. Hochstrasser, Pressereferent der Schweizer Gesandtschaft in Berlin; Dr. Winter, der Koadjutor des katholischen Bischofs von Berlin - damit er meine Informationen an den Bischof und den Papst weiterleiten kann; Dr. Dibelius [Bischof der Bekennenden Kirche] und viele andere. Auf diese Weise wurden Tausende von Menschen von mir informiert.11
Während die Monate vergingen und die Alliierten nichts unternommen hatten, um die Ausrottung zu stoppen, wurde Gerstein zunehmend hektischer.
[H] er verhielt sich seltsam rücksichtslos und riskierte jedes Mal unnötig sein Leben, wenn er von den Vernichtungslagern gegenüber Personen sprach, die er kaum kannte, die nicht in der Lage waren zu helfen, die aber leicht gefoltert und verhört worden wären ... 12
Selbstmord oder Mord
Am 22. April 1945, kurz vor Kriegsende, kontaktierte Gerstein die Alliierten. Nachdem er seine Geschichte erzählt und seine Dokumente gezeigt hatte, wurde Gerstein in Rottweil in "ehrenhafter" Gefangenschaft "gehalten - dies bedeutete, dass er im Hotel Mohren untergebracht war und sich nur einmal am Tag bei der französischen Gendarmerie melden musste.13
Hier hat Gerstein seine Erlebnisse niedergeschrieben - sowohl in französischer als auch in deutscher Sprache.
Zu dieser Zeit wirkte Gerstein optimistisch und zuversichtlich. In einem Brief schrieb Gerstein:
Nach zwölf Jahren unablässigen Kampfes und insbesondere nach den letzten vier Jahren meiner äußerst gefährlichen und anstrengenden Tätigkeit und den vielen Schrecken, die ich erlebt habe, möchte ich mich mit meiner Familie in Tübingen erholen. 14
Am 26. Mai 1945 wurde Gerstein bald nach Konstanz und Anfang Juni nach Paris verlegt. In Paris behandelten die Franzosen Gerstein nicht anders als die anderen Kriegsgefangenen. Er wurde am 5. Juli 1945 in das Militärgefängnis Cherche-Midi gebracht. Die Bedingungen dort waren schrecklich.
Am Nachmittag des 25. Juli 1945 wurde Kurt Gerstein tot in seiner Zelle aufgefunden und mit einem Teil seiner Decke aufgehängt. Obwohl es sich anscheinend um einen Selbstmord handelte, besteht immer noch eine Frage, ob es sich möglicherweise um einen Mord handelte, der möglicherweise von anderen deutschen Gefangenen begangen wurde, die nicht wollten, dass Gerstein redet.
Gerstein wurde auf dem Thiais-Friedhof unter dem Namen "Gastein" beigesetzt. Aber auch das war nur vorübergehend, denn sein Grab befand sich auf einem Teil des Friedhofs, der 1956 zerstört wurde.
Verdorben
1950 wurde Gerstein ein letzter Schlag versetzt - ein Entnazifizierungsgericht verurteilte ihn posthum.
Nach seinen Erfahrungen im Belzec-Lager hätte er sich mit aller Kraft, die ihm zur Verfügung stand, als Werkzeug eines organisierten Massenmordes widersetzen müssen. Das Gericht ist der Ansicht, dass der Angeklagte nicht alle ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausgeschöpft und andere Mittel und Wege gefunden haben könnte, um sich von der Operation fernzuhalten…
In Anbetracht der mildernden Umstände, die festgestellt wurden, hat das Gericht den Angeklagten nicht zu den Hauptverbrechern gezählt, sondern ihn zu den "Besudelten" gezählt.15
Erst am 20. Januar 1965 wurde Kurt Gerstein vom baden-württembergischen Ministerpräsidenten von allen Anklagen befreit.
Endnoten
- Saul Friedländer, Kurt Gerstein: Die Mehrdeutigkeit des Guten (New York: Alfred A. Knopf, 1969) 37.
- Friedländer, Gerstein 37.
- Friedländer, Gerstein 43.
- Friedländer, Gerstein 44.
- Brief von Kurt Gerstein an Verwandte in den USA, wie in Friedländer zitiert, Gerstein 61.
- Bericht von Kurt Gerstein, zitiert in Yitzhak Arad, Belzec, Sobibor, Treblinka: Die Operation Reinhard Todeslager (Indianapolis: Indiana University Press, 1987) 102.
- Bericht von Kurt Gerstein wie in Arad zitiert, Belzec 102.
- Friedländer, Gerstein 109.
- Friedländer, Gerstein 124.
- Bericht von Kurt Gerstein wie in Friedländer zitiert, Gerstein 128.
- Bericht von Kurt Gerstein wie in Friedländer zitiert, Gerstein 128-129.
- Martin Niemöller wie in Friedländer zitiert, Gerstein 179.
- Friedländer, Gerstein 211-212.
- Brief von Kurt Gerstein wie in Friedländer zitiert, Gerstein 215-216.
- Urteil des Entnazifizierungsgerichts Tübingen vom 17. August 1950, zitiert in Friedländer, Gerstein 225-226.
Literaturverzeichnis
- Arad, Yitzhak. Belzec, Sobibor, Treblinka: Die Operation Reinhard Todeslager. Indianapolis: Indiana University Press, 1987.
- Friedländer, Saul. Kurt Gerstein: Die Mehrdeutigkeit des Guten. New York: Alfred A. Knopf, 1969.
- Kochan, Lionel. "Kurt Gerstein." Enzyklopädie des Holocaust. Ed. Israel Gutman. New York: Macmillan Library Reference USA, 1990.
