Nietzsches Konzept des Willens zur Macht
 Share
Share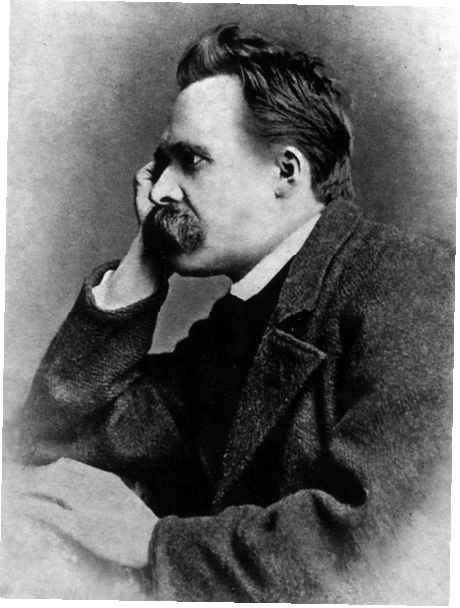
Der Wille zur Macht ist ein zentraler Begriff in der Philosophie des deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche aus dem 19. Jahrhundert. Es ist am besten als irrationale Kraft zu verstehen, die in allen Individuen zu finden ist und zu verschiedenen Zwecken geleitet werden kann. Nietzsche erforschte die Idee des Willens zur Macht während seiner gesamten Karriere und kategorisierte sie an verschiedenen Stellen als psychologisches, biologisches oder metaphysisches Prinzip. Aus diesem Grund ist der Wille zur Macht auch eine der am meisten missverstandenen Ideen von Nietzsche.
Ursprung der Idee
In seinen frühen Zwanzigern las Nietzsche "Die Welt als Wille und Repräsentation" von Arthur Schopenhauer und geriet in seinen Bann. Schopenhauer bot eine zutiefst pessimistische Vision des Lebens, und im Mittelpunkt stand seine Idee, dass eine blinde, unaufhörlich strebende, irrationale Kraft, die er „Wille“ nannte, das dynamische Wesen der Welt ausmacht. Dieser kosmische Wille manifestiert sich oder drückt sich durch jedes Individuum in Form des sexuellen Triebs und des in der Natur sichtbaren „Willens zum Leben“ aus. Es ist die Quelle von viel Elend, da es im Wesentlichen unersättlich ist. Das Beste, was man tun kann, um sein Leiden zu lindern, ist, Wege zu finden, es zu beruhigen. Dies ist eine der Funktionen der Kunst.
In seinem ersten Buch "Die Geburt der Tragödie" setzt Nietzsche einen "dionysischen" Impuls als Quelle der griechischen Tragödie. Wie Schopenhauers Testament ist es eine irrationale Kraft, die aus dunklen Ursprüngen aufsteigt und sich in wilder Betrunkenheit, sexueller Verlassenheit und Festen der Grausamkeit ausdrückt. Seine spätere Vorstellung vom Willen zur Macht ist deutlich anders, aber sie behält etwas von dieser Idee einer tiefen, vorrationalen, unbewussten Kraft bei, die genutzt und transformiert werden kann, um etwas Schönes zu schaffen.
Der Wille zur Macht als psychologisches Prinzip
In frühen Werken wie "Human, All Too Human" und "Daybreak" widmet sich Nietzsche vor allem der Psychologie. Er spricht nicht explizit von einem „Willen zur Macht“, sondern erklärt immer wieder Aspekte des menschlichen Verhaltens als Wunsch nach Herrschaft oder Beherrschung über andere, sich selbst oder die Umwelt. In "The Gay Science" wird er expliziter, und in "Thus Spoke Zarathustra" verwendet er den Ausdruck "Wille zur Macht".
Menschen, die mit Nietzsches Schriften nicht vertraut sind, neigen möglicherweise dazu, die Idee des Willens zur Macht ziemlich grob zu interpretieren. Aber Nietzsche denkt nicht nur oder vor allem an die Motivationen hinter Menschen wie Napoleon oder Hitler, die ausdrücklich militärische und politische Macht anstreben. Tatsächlich wendet er die Theorie typischerweise ziemlich subtil an.
Zum Beispiel Aphorism 13 von "The Gay Science"trägt den Titel "The Theory of the Sense of Power". Hier argumentiert Nietzsche, dass wir Macht über andere Menschen ausüben, indem wir ihnen Nutzen bringen und sie verletzen. Wenn wir sie verletzen, fühlen sie unsere Macht auf eine grobe Art und Weise - und auch auf eine gefährliche Art und Weise, da sie versuchen können, sich zu rächen. Jemanden uns gegenüber zu verschulden, ist normalerweise eine bevorzugte Methode, um ein Gefühl für unsere Macht zu entwickeln. Wir erweitern damit auch unsere Macht, denn die, die wir nutzen, sehen den Vorteil, auf unserer Seite zu sein. Tatsächlich argumentiert Nietzsche, dass es im Allgemeinen weniger angenehm ist, Schmerz zu verursachen, als Freundlichkeit zu zeigen, und schlägt sogar vor, dass Grausamkeit, weil sie die schlechtere Option ist, ein Zeichen dafür ist fehlt Leistung.
Nietzsches Werturteile
Der Wille zur Macht, wie Nietzsche ihn sich vorstellt, ist weder gut noch schlecht. Es ist ein grundlegender Antrieb, der in jedem anzutreffen ist, der sich jedoch auf viele verschiedene Arten ausdrückt. Der Philosoph und der Wissenschaftler lenken ihren Willen zur Macht in einen Willen zur Wahrheit. Künstler kanalisieren es in einen Willen zur Schaffung. Geschäftsleute befriedigen es, indem sie reich werden.
In "Über die Genealogie der Moral" stellt Nietzsche "Meister-Moral" und "Sklaven-Moral" gegenüber, führt aber beides auf den Willen zur Macht zurück. Wertetabellen zu erstellen, sie den Menschen aufzuzwingen und die Welt danach zu beurteilen, ist ein bemerkenswerter Ausdruck des Willens zur Macht. Und diese Idee liegt Nietzsches Versuch zugrunde, moralische Systeme zu verstehen und zu bewerten. Die starken, gesunden, meisterhaften Typen setzen ihre Werte souverän direkt in die Welt um. Im Gegensatz dazu versuchen die Schwachen, ihre Werte schlauer und umständlicher durchzusetzen, indem sie die Starken für ihre Gesundheit, Stärke, ihren Egoismus und ihren Stolz schuldig machen.
Während der Wille zur Macht an sich weder gut noch schlecht ist, bevorzugt Nietzsche ganz klar einige Arten, in denen er sich anderen gegenüber ausdrückt. Er befürwortet nicht das Streben nach Macht. Vielmehr lobt er die Sublimation des Willens zur schöpferischen Betätigung. Grob gesagt lobt er diese Äußerungen, die er als kreativ, schön und lebensbejahend ansieht, und kritisiert Äußerungen des Willens zur Macht, die er als hässlich oder aus Schwäche geboren ansieht.
Eine besondere Form des Willens zur Macht, auf die Nietzsche viel Wert legt, ist das, was er als „Selbstüberwindung“ bezeichnet. Hier wird der Wille zur Macht genutzt und auf Selbstbeherrschung und Selbsttransformation ausgerichtet, angeleitet von dem Prinzip „dein Wirkliches“ Das Selbst liegt nicht tief in dir, sondern hoch über dir. “
 Charles Darwin. Historisches Bildarchiv / Getty Images
Charles Darwin. Historisches Bildarchiv / Getty Images Nietzsche und Darwin
In den 1880er Jahren las und schien Nietzsche von mehreren deutschen Theoretikern beeinflusst worden zu sein, die Darwins Bericht über den Verlauf der Evolution kritisierten. An mehreren Stellen kontrastiert er den Willen zur Macht mit dem "Willen zum Überleben", den er für die Grundlage des Darwinismus zu halten scheint. Tatsächlich setzt Darwin jedoch keinen Überlebenswillen voraus. Er erklärt vielmehr, wie sich Arten aufgrund natürlicher Selektion im Überlebenskampf entwickeln.
Der Wille zur Macht als biologisches Prinzip
Zuweilen scheint Nietzsche den Willen zur Macht als mehr als nur ein Prinzip zu positionieren, das Einblick in die tiefen psychologischen Beweggründe des Menschen gibt. Zum Beispiel hat er in "So sprach Zarathustra" Zarathustra sagen lassen: "Wo immer ich ein Lebewesen fand, fand ich dort den Willen zur Macht." Hier wird der Willen zur Macht auf das biologische Reich angewendet. Und in einem ziemlich einfachen Sinn könnte man ein einfaches Ereignis wie einen großen Fisch, der einen kleinen Fisch isst, als eine Form des Willens zur Macht verstehen; Der große Fisch zeigt die Beherrschung seiner Umwelt, indem er einen Teil der Umwelt in sich aufnimmt.
Der Wille zur Macht als metaphysisches Prinzip
Nietzsche erwog, ein Buch mit dem Titel „Der Wille zur Macht“ zu schreiben, veröffentlichte jedoch nie ein Buch unter diesem Namen. Nach seinem Tod veröffentlichte seine Schwester Elizabeth jedoch eine Sammlung seiner unveröffentlichten, von ihr selbst organisierten und herausgegebenen Notizen mit dem Titel "Der Wille zur Macht". Nietzsche besucht seine Philosophie der ewigen Wiederkehr in "The Will to Power", einer Idee, die bereits in "The Gay Science" vorgeschlagen wurde.
